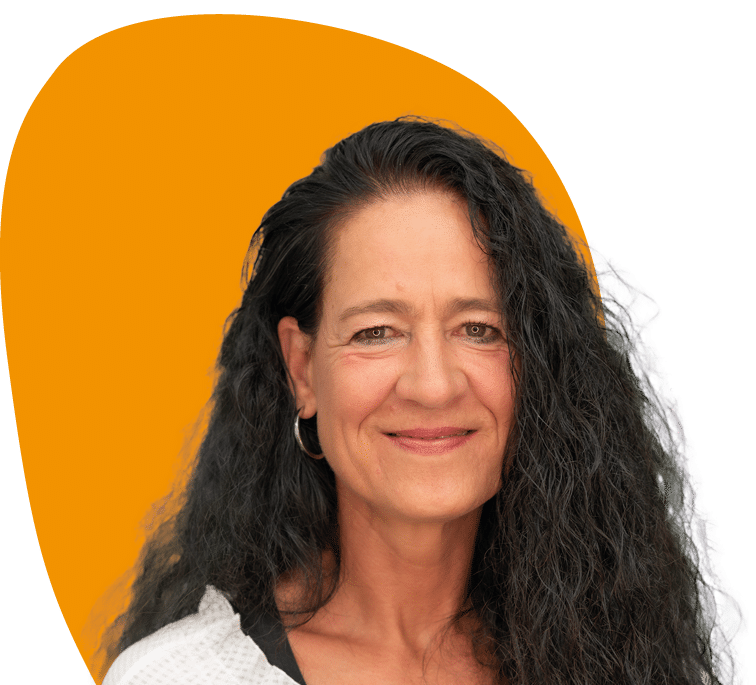Lunch & X-Change
Ihre Themenwünsche und Expert:innen für 2026
Damit Lunch & X-CHANGE auch im kommenden Jahr Impulse setzt, die Sie wirklich bewegen, möchten wir Sie einladen, uns Ihre Themenwünsche mitzuteilen.
Welche Fragestellungen, Trends oder Herausforderungen sollten wir 2026 gemeinsam in den Fokus nehmen?
Ebenso freuen wir uns sehr, wenn Sie selbst Spezialist:in in einem bestimmten Thema sind – oder Expert:innen kennen, die unsere Veranstaltungsreihe bereichern könnten. Geben Sie uns gerne entsprechende Hinweise!
Teilen Sie uns Ihre Ideen, Themenvorschläge und Expert:innenempfehlungen ganz einfach mit – über info@neuland-development.de.
Gestalten Sie Lunch & X-CHANGE aktiv mit!

BEYOND CERTAINTY –
WAS FÜHRUNG HEUTE WIRKLICH BRAUCHT
Die Welt verändert sich rasant und unvorhersehbar
Unsere neue Experten-Talk-Reihe Lunch & X-CHANGE setzt genau bei diesen Fragen an. Gemeinsam suchen wir nach Antworten, Ideen, Impulsen und schauen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema:
- Welche Führungshaltung, welche inneren Kompetenzen brauchen Führungskräfte? Und wie können sie entwickelt werden?
- Welches Wissen, welche Denkmodelle, Methoden und Tools sind hilfreich?
- Welche Implikationen ergeben sich daraus auf die Kultur, den Umgang miteinander und die Zusammenarbeit?
- Und welche Prozesse und Strukturen könnten – oder müssten sogar – losgelassen, angepasst oder neu geschaffen werden?
In jedem Gespräch wird ein Aspekt des vielschichtigen Themas im Vordergrund stehen.
Für wen ist das interessant?
-
für Geschäftsführer:innen & Inhaber:innen mittelständischer Unternehmen, die ihre Organisation strategisch weiterentwickeln wollen.
-
für Führungskräfte, die sich auf neue Leadership-Herausforderungen vorbereiten.
-
für HR-Entscheider:innen, die PE & OE als strategische Hebel nutzen.
-
für alle, die sich gerne vertieft mit spannenden Themen auseinandersetzen wollen.
Themen, die uns schon beschäftigt haben

Prof. em. Dr. phil. Theo Wehner
Ungewissheit ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wie können wir sie nicht nur aushalten, sondern ihr sogar etwas Konstruktives abgewinnen? Sie sogar als Entwicklungschance begreifen?
Bewusst Reflektieren und Emotionen zulassen
Das Privileg Zweifeln zu dürfen und Nicht-zu-Wissen
Die Bedeutung von Gemeinschaft
Konkrete Schritte für den Alltag
Einige Anregungen aus der Veranstaltung:
- Annehmen statt bekämpfen
Ungewissheit ist Teil des Lebens. Widerstand kostet Energie, während Akzeptanz neue Möglichkeiten eröffnet. - Innehalten und Ungewissheit bewusst wahrnehmen
Statt sie zu verdrängen, sich fragen: Was genau macht mich unsicher? Ist es eine reale Bedrohung oder vielleicht auch eine Möglichkeit? Und was könnte mir helfen, damit umzugehen? - Mut zur Improvisation
Sich selbst erlauben, Pläne anzupassen und neue Wege auszuprobieren. Und Improvisieren als ganz normal in beweglichen Prozessen zu begreifen – nicht als „Ausnahme“ oder „Verlegenheitslösung“. - Vertrauen kultivieren
Eigene Unsicherheiten und Zweifel mit anderen teilen, eine Fehlerkultur etablieren, die Fehler als Lernchance begreift und Räume zum gemeinsamen Reflektieren schaffen. - „Regelverletzungskompetenz“ erweitern
Regeln sind häufig auf der Basis alter Gewissheiten entstanden. Das bedeutet nicht, dass wir keine mehr brauchen. Aber wir brauchen an vielen Stellen mehr Kompetenz, Regeln infrage zu stellen und ggf. anzupassen. - Gemeinschaft nutzen
Der Austausch mit anderen kann helfen, Unsicherheit in einen konstruktiven Lernprozess zu verwandeln.

Prof. em. Dr. phil. Fritz Gairing
Gedanken zum Wandel aus einem Gespräch mit Fritz Gairing
die Komplexität und Dynamik unserer Zeit fordert uns heraus: als Menschen, als Teams, als Organisationen. Wie kann es uns dennoch gelingen, handlungsfähig zu bleiben? Wie führen wir durch Veränderungsprozesse, ohne in Aktionismus zu verfallen? Welche Kompetenzen und Denkweisen sind dafür erforderlich? Diesen und weiteren Fragen widmete sich unser letztes Lunch & X-Change mit Prof. Dr. Fritz Gairing. Mit seinem breiten Erfahrungsschatz aus Wissenschaft, Wirtschaft und Beratung sowie seinem feinen Gespür für Zwischentöne, hat er uns eine Stunde lang mit Gedanken, Metaphern und Erfahrungen beschenkt, die nachhallen. Hier fassen wir für Sie das Wichtigste zusammen:
In der Logik der Geschwindigkeit liegt eine der größten Versuchungen heutiger Veränderungsprozesse. Doch Gairing macht deutlich: „Aktionismus ist die subtilste Form von Widerstand“ – und häufig reines Blendwerk. Denn: Wer hektisch voranstürmt wirbelt Staub auf, geriert sich damit als Speerspitze der Veränderung, weicht oft der eigentlichen Auseinandersetzung aus und trägt dazu bei, dass sich am Ende nichts verändert. Transformation braucht Räume des Innehaltens. Sie beginnt nicht mit der Frage: „Was tun wir?“, sondern mit: „Was genau, soll danach anders sein – und warum? Woran merken wir das?“
Gairing benennt diese Fähigkeiten, die in komplexen Veränderungssituationen den Unterschied machen:
- Metakognition: Die eigene Perspektive reflektieren, blinde Flecken erkennen, Denkgewohnheiten in Frage stellen.
- Mut (Courage): Das Vertrauen, unbekanntes Terrain zu betreten, ohne schon zu wissen, wo es hinführt.
- Resilienz & Ambiguitätstoleranz: Die Fähigkeit, sich sie nicht schnell erschüttern zu lassen, „pragmatisch, zuversichtlich, nach vorne gedacht, vorzugehen“ und Mehrdeutigkeit auszuhalten.
- Methode: Die methodische Kompetenz, Transformationsprozesse wirksam zu gestalten, zu begleiten und zu halten.
Beteiligung ist mehr als Mitnahme
Transformation kann dort gelingen, wo Beteiligung echt gemeint ist. Wo unterschiedliche Perspektiven nicht nivelliert, sondern neugierig aufgenommen werden. Die Glaubwürdigkeit und das echte Commitment des Topmanagements sowie die „Beteiligung der Mitarbeiter suchen und annehmen“ sind neben ausreichenden Ressourcen kritische Erfolgsfaktoren von gelingender Transformation.
Widerstand ist normal – und kostbar!
Widerstand ist nicht das Problem. Er ist ein Zeichen von Engagement. Ein Impuls, der gehört werden will.
„Widerstand ist Energie. Die Frage ist, wie wir sie nutzen.“
Statt den Widerstand zu bekämpfen und ihn „also moralisches Defizit zu betrachten“, lohnt es sich, ihm zuzuhören. Was wird hier sichtbar? Welche Sorge, welches Bedürfnis, welche Angst?
Bedrohung oder Verheißung?
Veränderung beginnt oft mit einer Geschichte. Eine, die Angst macht – oder eine, die Hoffnung schenkt.
„Es gibt zwei Motive für Veränderung: Fight the Dragon oder Win the Princess.“
Manchmal geht es darum, Bedrohungen zu begegnen – Krisen, Marktveränderungen, interne Notlagen. Und manchmal geht es um eine Vision, die begeistert. Beides kann antreiben. Organisationen, die in Transformation gehen, tun gut daran, beides zu reflektieren: Was bedroht uns? Was zieht uns an? Die Kunst besteht darin, Angst in Energie und Sehnsucht in Richtung zu verwandeln.
Was hilft: Klarheit, Beziehung – und Humor
„Beratung ohne Humor ist witzlos.“ (nach Fritz Simon)
Ein Satz zum Schmunzeln und ein echtes Anliegen von Fritz Gairing: Transformation braucht nicht nur Strukturen, sondern auch Zwischenräume: für Dialog, Reflexion und die Erlaubnis, nicht alles sofort zu wissen. „Wenn das alles nur verkrampft und bierernst ist, dann geht was schief.“
Humor und Heiterkeit sind keine Nebensachen, sondern tragende Elemente. Sie öffnen emotionale Räume, machen Neues denkbar und erleichtern das gemeinsame Lernen.
Aus dem offenen Austausch nahmen die Teilnehmenden Impulse mit wie:
„Ruhe bewahren“, „Freude wecken“, „bewusst gestalten“, „Sichtweisen verändern und andere Perspektiven einnehmen.“
Transformation gelingt nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Bewusstheit. Nicht durch Perfektion, sondern durch Mut. Und nicht durch Kontrolle, sondern durch die Bereitschaft, sich auf das Unbekannte einzulassen. Es gibt kein Patentrezept.
Wir danken Fritz Gairing und allen Zuhörer- und Mitdenker:innen für diese inspirierende Stunde und laden Sie ein, diese Impulse weiterzutragen – und mit uns weiterzudenken.

Prof. Dr. Jörg Wendorff
Zwischen Faszination und Überforderung: Wo stehen wir?
Prof. Dr. Jörg Wendorff, Professor für Berufspädagogik, und Zoltan Boge, Informatiker und KI-Experte, schilderten eingangs ein differenziertes Lagebild: Es gibt sehr geteilte Reaktionen auf KI
- Begeisterung, teils unreflektiert.
- Überforderung, verbunden mit Rückzug oder Angst.
- Ignoranz, aus dem Gefühl heraus, nicht betroffen zu sein.
„Die größte Herausforderung ist vielleicht gar nicht die Technologie – sondern wie wir als Menschen damit umgehen.“ – Martin Merdes
Hochschulen als Mikrokosmos: Lernen neu denken
Einblicke aus der Hochschulpraxis zeigten, wie stark KI schon Teil des Alltags ist – aber auch, wie wenig offen darüber gesprochen wird. Laut Prof. Wendorff nutzen etwa 80 % der Studierenden KI-Tools – allerdings häufig heimlich. Unsicherheit, Scham und fehlende Klarheit darüber, was erlaubt ist, prägen den Alltag.
„Ich wünsche mir eine offenere Gesprächskultur. Wer KI nutzt, ist nicht faul – sondern neugierig. Aber das müssen wir sichtbar machen.“ – Prof. Dr. Jörg Wendorff
KI stellt damit nicht nur technische Fragen, sondern auch pädagogische und kulturelle:
- Wie kann Lernen mit, statt gegen KI gelingen?
- Was bleibt der Wert von Bildung, wenn Wissen jederzeit generiert werden kann?
- Und wie begleiten wir Lernende und Lehrende gleichermaßen im Wandel?
Tools sind nicht die Lösung – aber ein guter Anfang
Zoltan Boge betonte: „Die meisten suchen das eine Supertool. Aber entscheidender ist, wie wir es nutzen. Je klarer wir selbst sind, desto besser das Ergebnis.“
Der Schlüssel: Experimentieren – und das regelmäßig. Am besten nicht mit der Absicht, sofort perfekt zu sein, sondern mit Neugier: Was kann ich mit ChatGPT heute Neues lernen, schreiben, entdecken? Ein kleiner Alltags-Prompt – etwa: Was kann ich mit dem Inhalt meines Kühlschranks kochen? – kann der Einstieg in eine langfristige Beziehung mit KI sein.
Kritisches Denken bleibt essenziell
Einigkeit bestand in einem Punkt: KI ersetzt keine menschliche Urteilsfähigkeit. Gerade weil KI sehr überzeugend klingen kann – selbst wenn sie Unsinn erzählt –, ist kritische Reflexion wichtiger denn je.
Wichtig ist, eine eigene Haltung zu entwickeln:
- Wie will ich KI nutzen?
- Wo liegen ihre Grenzen?
- Wie erkenne ich Qualität in den Ergebnissen?
„KI darf keine Blackbox bleiben – sonst werden wir blind für ihre Schwächen. Und für unsere Verantwortung.“ – Zoltan Boge
Gestaltung statt Getrieben-Sein: KI ist auch eine Kulturfrage
KI ist nicht nur ein Tool – sondern auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Wer darf sie nutzen? Wofür? Und wie schaffen wir es, dass sie nicht zu noch mehr Spaltung führt?
Impulse aus dem Gespräch:
- Unser Bildungssystem überdenken
Unser Bewertungssystem in der Schule beruht in großen Teilen auf Wissen und unseren Kindern wird vermittelt: erfolgreich ist, wer viel weiß! Hier sollte anders angesetzt und andere Qualitäten in den Fokus rücken wie z.B. Denkfähigkeit, Empathie, Kritisches Denken & Denken in Beziehungen und Wechselwirkungen. - Räume schaffen
Es braucht Dialog, Austausch, Experimentierräume. - Als Organisation zur Nutzung von KI einladen und klar kommunizieren
Unsicherheit zur Nutzung ausräumen und einen klaren Rahmen setzen, wie KI genutzt werden darf und welche Grenzen es gibt. - Menschlichkeit stärken
Die Fähigkeiten, die Maschinen (noch) nicht haben – Empathie, Beziehungsgestaltung, ethisches Denken – werden immer zentraler.
Datenschutz: ein ungelöster Konflikt
Ein zentrales Thema war auch der Datenschutz. Während die Technologie rasant voranschreitet, hinken rechtliche Rahmen oft hinterher – insbesondere in Europa. Was darf ich eingeben? Welche Daten sind tabu? Welche Tools sind sicher? Die Gesprächspartner waren sich einig: Es braucht klare Leitplanken – und eine europäische oder deutsche KI-Alternative, die rechtliche Sicherheit schafft.
„Wenn wir zu restriktiv sind, verpassen wir riesige Chancen – gerade im medizinischen Bereich. Aber wenn wir alles freigeben, verlieren wir Vertrauen. Wir brauchen eine Lösung dazwischen.“ – Prof. Dr. Jörg Wendorff
KI als Einladung zum persönlichen Wachstum
Ob als Coach, Führungskraft, Trainerin oder Studierende: Wir alle stehen vor der Aufgabe, unseren eigenen Umgang mit KI zu gestalten. Das kann unbequem sein – es ist aber auch eine große Chance.
„Niemand hat nach dieser Veränderung gefragt. Aber sie ist da. Und sie geht nicht wieder weg. Jetzt ist die Frage: Was machen wir daraus?“ – Zoltan Boge
Fazit: KI verändert uns – aber wir gestalten mit
Der Talk machte deutlich:
- KI kann entlasten – wenn wir lernen, sie sinnvoll zu nutzen.
- KI erfordert neue Kompetenzen – aber auch Mut zur Lücke.
- KI wirft Fragen auf – die wir als Gesellschaft gemeinsam beantworten müssen. Zum Beispiel: Worin liegen die wirklich menschlichen Qualitäten? Welche Selbstbilder gilt es loszulassen?
Was bleibt, ist die Einladung: Nicht warten – sondern anfangen. Ob in kleinen Experimenten, kollegialem Austausch oder strategischer Auseinandersetzung: KI ist nicht die Zukunft. KI ist Gegenwart.
Sie möchten mit Ihrer Organisation ins Tun kommen?
Neuland Development unterstützt Sie mit …
- Offenen Workshops zur Nutzung von KI
Unsere KI-Experten teilen ihr aktuelles Wissen rund um Hintergründe und die effektive Nutzung von KI. Gleichzeitig öffnen wir hier den Raum zum individuellen Experimentieren und gemeinsamen Lernen.
Nächste Termine: 20. August und 29. Oktober 2025
Anmeldung und weitere Infos hier. - Inhouse-Veranstaltungen für Ihre Mitarbeiter:innen
- Beratung und Trainings rund um Gestaltung einer KI-Lernkultur in Ihrem Unternehmen
- Dialogformate mit Personalentwickler:innen: mit- und voneinander lernen, Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig inspirieren
Schreiben Sie uns – wir helfen Ihnen, Ihre Fragen zu sortieren, Potentiale zu erkennen und Ihren eigenen Weg zu finden.

Prof. Dipl. Des. Kai Beiderwellen
Futurescape Dynamics – Die Zukunft gestalten, statt sie nur kommen zu lassen
Zwischen Nebellichtern, Störungen und Möglichkeitsräumen
Im letzten Lunch & X-CHANGE ging es nicht um Pläne mit Checklisten, sondern um Kompasse im Nebel. Martin Merdes von Neuland Development und Prof. Kai Beiderwellen öffneten gemeinsam mit den Teilnehmenden den Blick auf ein anderes Verständnis von Zukunft: Zukunft nicht als Zielpunkt, sondern als Landschaft voller Pfade, Signale und Überraschungen.
Zukunft beginnt mit einer Frage
Nicht mit der Antwort. Nicht mit Planung. Sondern mit der Frage:
„In welcher Zukunft wollen wir leben?“
Wer diese Frage ernst nimmt, verlässt das Terrain der Sicherheiten – und betritt einen Möglichkeitsraum. Einen Raum, in dem Unsicherheit nicht als Bedrohung, sondern als fruchtbarer Boden für Neues verstanden wird.“ – Martin Merdes
„Wenn ich nicht gestört werde, fange ich nicht an zu denken.“
Disruption, so Beiderwellen, ist kein Defekt, sondern ein Weckruf. Wer nur in geraden Linien denkt, übersieht das Netz aus Nebenwegen, Umwegen, Umbrüchen. Zukunft braucht zirkuläre Beweglichkeit statt planerischer Starrheit.
Frühwarnsysteme & Signale
„Zukunft sendet Signale – kleine Irritationen, Fundstücke, Trends in der Peripherie. Ein gutes Zukunftsdesign gleicht einem Frühwarnsystem mit Fühlern in alle Richtungen. Es übersetzt schwache Zeichen in Szenarien und Prototypen.
Beispielhaft: Aus dem Wachstumsmuster von Korallen entstehen Konzepte für neue Wasserfilter – und Ideen für Geschäftsmodelle von Tauchlehrern als Korallenfarmer.
Die Zumutung des Suchens
Zukunftsgestaltung heißt: Suchen ohne Garantie.
Wir mögen Happy Ends – aber Zukunft hat keinen Schlussakt. Wer Zukunft gestalten will, braucht Geduld, Neugier und die Bereitschaft, sich selbst immer wieder infrage zu stellen.
Führung mit Narrenkappe
„Was wäre, wenn Führung darin bestünde, die unbequemen Fragen zu stellen?“ Beiderwellen schlägt ein Bild vor: eine Narrenkappe für Führung, die schützt, wenn Dinge gesagt werden, die sonst nicht ausgesprochen werden dürfen.
Fazit:
Zukunft wird nicht geplant – sie wird verhandelt. Wer gestalten will, muss Fragen zulassen, Muster brechen, sich überraschen lassen.
Wir helfen Ihnen dabei, solche Möglichkeitsräume im Unternehmen zu schaffen.

Michéle Neuland
Agilität auf dem Prüfstand – Haltung schlägt Methode
Agilität ist seit Jahren ein Buzzword – aber was bedeutet es wirklich für Organisationen, Führungskräfte und Mitarbeitende? Michèle Neuland und Martin Merdes von Neuland Development tauschten sich über Erfahrungen, Chancen und Grenzen agiler Arbeitsweisen aus. Dabei wurde deutlich: Agilität ist kein Allheilmittel, sondern eine Haltung und ein Werkzeug, das bewusst eingesetzt werden muss.
Erfolgsfaktoren für Agilität
Ein roter Faden durch das Gespräch: Agilität gelingt nicht durch Methoden allein, sondern durch die Kombination von Haltung, Kultur und passender Anwendung.
Michèle Neuland betonte:
„Ich glaube nicht, dass Agilität an sich als Methode die Antwort ist, sondern wir brauchen eine entsprechende Haltung.“
Agilität ist für sie kein neues Betriebssystem, das man einfach installiert. Sie ist eine innere Haltung, die sich zeigt in Eigenverantwortung, Vertrauen, Lernbereitschaft, Selbstreflexion – und darin, Unsicherheit nicht als Bedrohung, sondern als Teil des Spiels zu begreifen.
Entscheidend sei auch, die richtige Balance zu finden und nicht alle bisherigen Strukturen auf einmal über Bord zu werfen: „Es ist eine Beidhändigkeit – wir brauchen sowohl tradierte als auch agile Formate, je nachdem, was passt.“
Gefahren bei der Einführung von Agilität
Im Gespräch wurde auch deutlich, was Agilität scheitern lässt:
- Überforderung durch Methodenfetisch: „Wir haben einfach nur ein Framework drüber gekippt und gehofft, dass das automatisch Haltung entwickelt – und das passiert eben nicht.“
- Zu kurze Zeiträume: Erwartung, dass nach einem halben Jahr schon Erfolge sichtbar sind. „In den meisten Fällen dauert dieser Prozess mindestens ein bis zwei Jahre, bis er wirklich in Effizienz übergeht.“
- Unklare Rollen: Wenn tradierte Funktionen einfach umbenannt werden („alle Abteilungsleiter werden Product Owner“), ohne neue Verantwortung zu definieren.
- Falsch besetzte Schlüsselrollen: „Wenn ein Scrum Master nur noch Meeting Minutes macht, dann ist das eher eine Sekretariatsfunktion als eine Begleitfunktion.“
- Überzogene Erwartungen: Agilität als Heilsbringer für Umsatzsteigerung oder Produktivität – ohne die nötige kulturelle Transformation.
Kompetenzen für agiles Arbeiten & Anforderungen an Führungskräfte
Mitarbeitende brauchen Kompetenzen wie
- Selbstorganisation und Eigenverantwortung
- Kooperations- und Feedbackfähigkeit
- Offenheit für Experimente und Lernprozesse
Michèle Neuland fasste dies unter dem Begriff des Growth Mindsets:
„Menschen, die offen sind, Erfahrungen zu machen und zu lernen, haben weniger Angst davor, in unsichere Situationen zu gehen.“
Neue Rolle von Führung
Agilität verschiebt die Spielregeln – vor allem für Führungskräfte. Statt Steuerleuten, die jeden Handgriff anweisen, braucht es heute Architekten, die Räume gestalten:
- Rolle als Enabler und Coach: „Führung heißt, Rahmen zu bauen, in dem Selbstorganisation und Verantwortungsübernahme gut funktionieren.“
- Loslassen lernen: Statt Mikromanagement Vertrauen in die Kompetenz der Teams setzen.
- Situativ entscheiden: „Eine zentrale Führungsherausforderung ist, klar zu haben: Was für ein Feld habe ich gerade vor mir – und welche Arbeitsweise passt dazu?“
- Kulturarbeit: Führungskräfte sind gefragt, Feedback- und Lernkultur aktiv zu fördern.
Fazit
Agilität ist kein Wundermittel, sondern ein Werkzeug, das sinnvoll eingesetzt werden will. „Es ist eine Bereicherung des Portfolios – und damit virtuos umzugehen, das ist unsere gemeinsame Herausforderung.“
Statt schnelle Erfolge zu erwarten, braucht es Zeit, Haltung und bewusste Führung. Wer Agilität als Haltung und Kulturarbeit versteht, kann Unsicherheit produktiv nutzen, Innovation beschleunigen und Zusammenarbeit stärken.
Agilität ist weder Wundermittel noch Modetrend. Sie ist wie ein scharfes Werkzeug: nutzlos, wenn es unbedacht eingesetzt wird – aber kraftvoll, wenn Haltung, Kultur und Führung zusammenspielen.
Haltung – wissenschaftlich erklärt
Forschung zeigt, dass Agilität nur dann Wirkung entfaltet, wenn Teams und Führungskräfte ein agiles Mindsetentwickeln. Dieses Mindset besteht aus mehreren Haltungen, die sich in Verhalten übersetzen lassen:
- Lernbereitschaft & Fehlerfreundlichkeit: Fehler als Lernquelle nutzen, Retrospektiven ernst nehmen.
- Psychologische Sicherheit: Offen Bedenken äußern können, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.
- Ownership / Verantwortung: Teams übernehmen Verantwortung für Ergebnisse, nicht nur für Aufgaben.
- Vertrauen & Transparenz: Informationen teilen, Ziele und Entscheidungen offen kommunizieren.
- Offenheit für Unsicherheit & Adaptivität: Unklarheiten aushalten, iterativ vorgehen.
- Kooperationsorientierung: Interdisziplinär zusammenarbeiten und Wissen teilen.
- Growth Mindset: Überzeugung, dass Fähigkeiten entwickelbar sind – Lernen steht über Status.
3-Punkte-Check für Teams:
- Finden bei uns regelmäßig Retrospektiven mit echten Learnings statt?
- Kann jede:r im Team ohne Angst Bedenken äußern?
- Trifft das Team Entscheidungen eigenständig und übernimmt Verantwortung?
Wenn eine dieser Fragen mit „Nein“ beantwortet wird, lohnt es sich, gezielt an Haltung zu arbeiten – z. B. durch Coaching, Feedbacktrainings oder Pilotprojekte.

Iris Teicher
Dieser Lunch & X-CHANGE hat kraftvoll gezeigt, wie echte Dialoge frische Perspektiven auf Führung und Resilienz eröffnen. Inspiriert von Ihren Fragen und Beiträgen haben Iris Teicher und Michael Schleppe gemeinsam herausgearbeitet, wie Teams widerstandsfähiger durch den digitalen Wandel navigieren können.
Kontext & Relevanz
Unsere Stunde begann mit einem kurzen Ankommen und bewusstem Innehalten: Transformation geschieht dort, wo innere Haltung und äußeres Handeln zusammenkommen. Gemeinsam reflektierten wir die Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt – Tempo, Informationsflut und die Verschmelzung von Privat- und Berufsleben stellen Führung und Teams täglich auf die Probe. Die zentrale Frage: Wie können wir Raum für Klarheit, vertrauensvolle Führung und mutige Veränderung schaffen?“
Digitale Resilienz – Tiefer verstanden
Wir haben den Begriff „digitale Resilienz“ neu beleuchtet. Neben dem souveränen Umgang mit digitalen Tools stand insbesondere die innere Widerstandskraft im Fokus. Offenheit für Unsicherheiten, das Zulassen von Fehlern und die bewusste Förderung psychologischer Sicherheit wurden als Schlüssel zum Erfolg diskutiert – wissenschaftlich fundiert und praktisch relevant für innovative, lernbereite Teams.
Dabei verstehen wir digitale Resilienz als Kernkompetenz für eine neue Arbeitswelt – basierend auf dem gleichnamigen Essentials-Buch von Iris Teicher und Stefan Burges. Ihr interdisziplinärer Ansatz integriert vier integrale Ebenen: die technologische, soziale, psychologische und neurobiologische. Dieses Zusammenspiel eröffnet ein tiefes Verständnis dafür, wie Menschen und Organisationen im digitalen Wandel Stabilität, Lernfähigkeit und Innovationskraft vereinen können. So wird digitale Resilienz zum Schlüssel für nachhaltige Performance und Führung mit Weitblick in einer sich permanent verändernden Welt.
Impulse & Fragen aus der Community
Im offenen Austausch gingen wir insbesondere auf die Führung auf Distanz und das Schaffen echter Nähe in virtuellen Räumen ein. Es wurde bestätigt, dass Wertschätzung, Vertrauen und Teamrituale aktiv gestaltet werden müssen. Kollegiale Beratung, kontinuierliche Reflexion und die Bereitschaft, das eigene Nicht-Wissen zu zeigen, sind Basis für Orientierung und eine zukunftsfähige Zusammenarbeit.
In praktischen Übungen und Diskussionsrunden haben wir folgende Formate erlebt und reflektiert:
- Achtsamkeitsübungen und Micro-Pausen zur Stressreduktion
- Persönliche Check-ins und „Lessons Learned“-Formate als Türöffner für ehrliche Begegnung und gemeinsames Lernen
- Generationsübergreifender Austausch und gezielte Reflexionsrunden als Booster für neue Impulse
- Gesunde Routinen und offene Fehlerkultur als Fundament einer widerstandsfähigen Organisation
Stimmen & Erkenntnisse
Die Teilnehmenden berichteten, wie zentral psychologische Sicherheit, geteilte Werte und gelebte Wirksamkeit für erfolgreiche und nachhaltige Transformation sind. Besonders gewürdigt wurde die Offenheit für Unsicherheiten als Basis für Innovation.
Inner Development Goals (IDGs)*
Mit den Inner Development Goals (IDGs) haben wir ein wissenschaftlich fundiertes Framework integriert, das den Wandel von innen heraus unterstützt:
Being: Präsenz, Selbstwahrnehmung und innere Stabilität
Thinking: Systemisches Denken, Perspektivenwechsel und Komplexität erfassen
Relating: Empathie, vertrauensvolle Beziehungen und gegenseitige Wertschätzung
Collaborating: Co-Kreation und kollektives Lernen
Acting: Mutiges, verantwortungsvolles Handeln
Diese fünf Dimensionen gestalten Entwicklung als dynamischen Prozess – individuell, im Team und in der Organisation. Das IDG Framework fungiert dabei als Bridging Framework, das den Wandel zwischen innerer und äußerer Transformation verbindet. Es schafft eine integrative Brücke zwischen persönlicher Entwicklung und organisatorischem Wandel, indem es individuelle Bewusstseinsarbeit mit kollektiven Veränderungsprozessen verknüpft. So wird Transformation nicht nur als äußere Anpassung verstanden, sondern als ganzheitlicher Prozess, der innere Haltung, Zusammenarbeit und wirkungsorientiertes Handeln miteinander in Einklang bringt.
Konkreter Praxistipp
Verankern Sie Formate für offenes Feedback und Reflexion im Team – nach Projekten, Sprints oder Meetings. Teams, die psychologische Sicherheit leben und Fehler als Lernchance begreifen, sind resilienter, innovativer und bereit für die Zukunft.
*IDG Initiative / 29k Foundation. (2021). Inner Development Goals – Transformational skills for sustainable development. Stockholm: 29k Foundation.
Gestalten Sie mit uns Ihre Führungs-Zukunft.
Als Beratungsunternehmen für Personal- und Organisationsentwicklung begleiten wir Unternehmen durch Transformationen – mit Fokus auf Führung, Unternehmenskultur und nachhaltige Veränderungsprozesse.


Julia Auth
Teamassistenz Personal- und Organisationsentwicklung
Wir beraten Sie gern!
Julia.auth@neuland-development.de